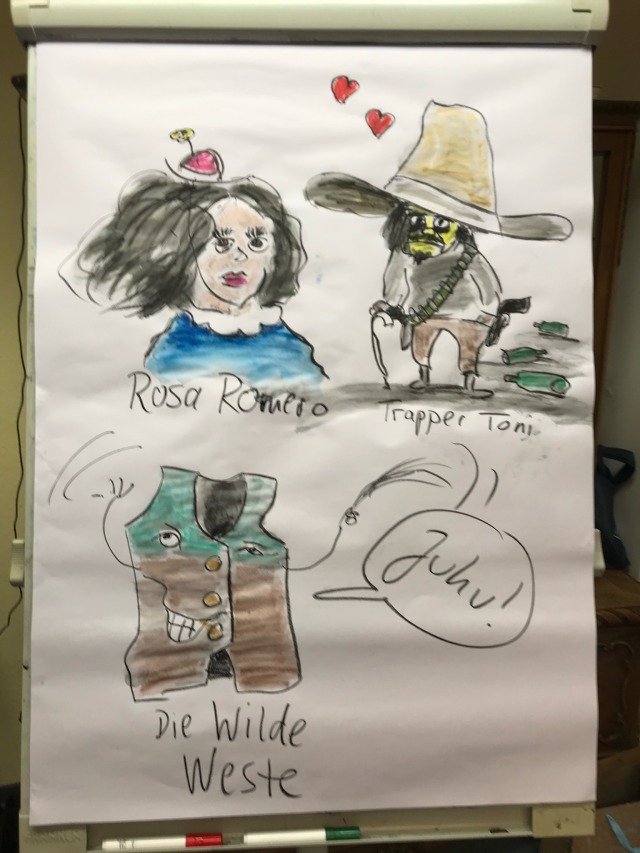Die stille, zurückhaltende, fast schüchtern wirkende Frau S. kommt seit einigen Monaten in meine Mal- und Kreativrunde. Wobei „kommt“ leicht übertrieben ist, denn von alleine kommt sie nirgendwo hin. Einmal weil sie im Rollstuhl sitzt, zum anderen (und im wesentlichen) weil sie aufgrund ihrer Demenz keinerlei Antrieb hat und zeitlich wie räumlich stark desorientiert ist.
Sie antwortet immer mit einem freundlichen „Ok!“ oder „Ja, gerne!“, wenn ich sie frage, ob sie wieder mit zum Malen kommen möchte; außerdem ist ihr in der Gruppe anzumerken, dass sie Freude im Umgang mit den Farben findet, die sie auf das feuchte Aquarellpapier tupft und pinselt.
Bei den letzten drei, vier Treffen allerdings ist mir aufgefallen, dass Frau S. kognitiv immer weiter eingeschränkt und verlangsamt wirkt. Ohne direkte Anleitung bei jedem Handgriff, bei jedem Arbeitsschritt, bleibt sie einfach auf ihrem Platz sitzen und blickt auf Material und Utensilien als handele es sich dabei um außerirdische Artefakte, deren Wesen und Bestimmung sich menschlichem Verständnis komplett entziehen. Wenn sie dann, nachdem ich bis zum Pinsel-in-die-Farbe-tunken ihr alles „mundgerecht“ eingerichtet habe, ins Malen kommt, erinnert sie an einen batteriebetriebenen Gegenstand, der am Anfang noch mit etwas Restladung ruckelt und zuckelt, dann immer langsamer wird, bis er zum Schluß ganz zum Stillstand kommt.
Auch heute wieder beginnt sie einigermaßen schwungvoll, malt Farbe auf das Blatt und bleibt dann mit dem Pinsel in der Hand sitzen, als hätte ihr jemand den Stecker gezogen. Ich lasse sie eine weitere Farbe aussuchen, tauche ihr den Pinsel in das Farbtöpfchen ein und überlasse sie ihrem Aquarellbild. Nach einer Weile schaue ich wieder nach ihr; sie hat tatsächlich ein bißchen weitergemalt, sitzt aber erneut wie in Trance vor ihrem Bild. „Na, Frau S., wie sieht’s aus? Wollen Sie noch einen neuen Bogen Papier?“ frage ich sie. Zu meinem Erstaunen antwortet sie: „Nein, ich möchte an diesem Bild weiter malen!“
Nach etwa zehn Minuten als ich erneut nach ihr schaue, wirkt sie besorgt und etwas beunruhigt. Sie sagt zu mir „Ich weiß ja nicht, wie ich von hier wieder dorthin komme, wo ich hin muss. Also dahin, wo ich wohne.“ Dabei schaute sie mich mit einem Ausdruck äußerster Verlorenheit und Desorientiertheit an. Ich spüre ihre essenzielle Unsicherheit und Ratlosigkeit in diesem für Sie unerklärlichen Universum, in dem sie sich – wie von der Hand eines ungnädigen Gottes abgesetzt – wiederfindet wie in einem Irrgarten, dessen Sinn und Zweck ihr rätselhaft sind und bleiben.
„Keine Sorge, Frau S.“, antworte ich ihr. „Ich bringe Sie dahin, wo sie jetzt wohnen. Sie wohnen ja jetzt bei uns hier, im Stift, nicht mehr in ihrer früheren Wohnung. Deswegen kommt Ihnen das alles manchmal so komisch vor…“. Dass ich ihre Verwirrung und Verlorenheit bemerke, anerkenne und darauf eingehe, erleichtert meine Gesprächspartnerin schon mal ein wenig. Sie erzählt mir ihre Sorge, dass „die Leute, die bei mir wohnen und die mich immer besuchen“ nicht wissen, wo sie ist und sie deswegen nicht finden können. Sie fragt sich bzw. mich, welche Verkehrsmittel sie benutzen müsse, um zu „diesen Leuten“ zu kommen. Damit meint sie ihre Söhne und ihre Schwiegertöchter, die nicht weit entfernt wohnen und von denen sie einigermaßen regelmäßig besucht wird.
Ich bringe Frau S. erstmal wieder in ihren Wohnbereich und erkläre ihr nochmal in kurzen, einfachen Worten und Sätzen, dass dies jetzt ihr Zuhause ist. Ich sage ihr, dass ich sehr gut weiß, dass das NICHT ihr Zuhause von früher ist, dass es aber für sie einfacher ist, hier zu leben, weil sie sich selber nicht mehr versorgen kann. Wir alle würden uns darum kümmern, dass sie sich hier wohl fühlt und alles bekommt, was sie braucht, versichere ich ihr.
Weil ich merke, dass sie im Moment alles überfordert und zu viele Sätze für sie eine Informationsüberlastung bedeuten, die sie nicht verarbeiten kann, schiebe ich sie in ihrem Rollstuhl den Gang zu ihrem Zimmer entlang. Ich zeige ihr die Tür, an der ihr Name steht, fahre mit ihr ins Zimmer hinein und wieder hinaus und bringe sie zurück in den Gemeinschaftsräume des Wohnbereichs, wo schon das Abendessen vorbereitet wird.
Das entspannt sie fürs erste, doch nach einer Weile winkt sie mich mit sehr besorgtem Gesichtsausdruck wieder zu sich: „Wie kann ich denn wissen, wie ich da hin gelange, wo die wohnen? Ich brauche doch irgendeine Sicherheit, dass die mich finden…“, teilt sie mir ihre innere Not und Furcht mit, dass die Reste der familiären emotionalen Verbindungen, die ihrem dementiell veränderten Gehirn noch zugänglich sind, auch noch verloren gehen.
Hier helfen jetzt nur noch praktische Maßnahmen, die einem dementen Menschen zugänglich und verständlich sind. Ich erkläre Frau S., dass ich mich jetzt persönlich darum kümmern würde, dass sie und ihre Verwandten immer zueinander finden. Die Sicherheit, die sie – ohne dass sie es so formulieren oder auch nur denken könnte – zurecht bedroht sieht durch den Fortschritt der Demenz, muss dieser in einem unüberschaubaren, unerklärlichen Universum verlorenen Frau vermittelt werden durch ganz simple und handfeste Dinge oder Zeichen. Ich gehe ins Büro, rufe mir am PC ihre Datei auf und notiere Namen, Adressen und Telefonnummern ihrer beiden Söhne auf zwei Zettel. Diese nehme ich wieder mit nach oben in den Wohnbereich und lege sie Frau S. links und rechts neben ihren Abendbrotteller.
Ich lese ihr die Namen ihrer Söhne vor, sie nickt und seufzt erleichtert auf. „Ach ja, genau, das sind sie!“ Irgendetwas scheint auf seinen Platz zu fallen in ihrem inneren Durcheinander und die ganze Frau wirkt etwas gelöster und ruhiger als zuvor. Vielleicht hat sie jetzt das Gefühl, dass die Sicherheit, die die Verbindung zu ihrer Familie für sie darstellt – oder dargestellt hat – noch nicht ganz dahin ist und dass es auch in diesen neuen, veränderten, unerklärlichen Umständen, in denen sie sich hier wiederfindet, eine Verbindung zum Kern ihrer Erinnerungen existiert.