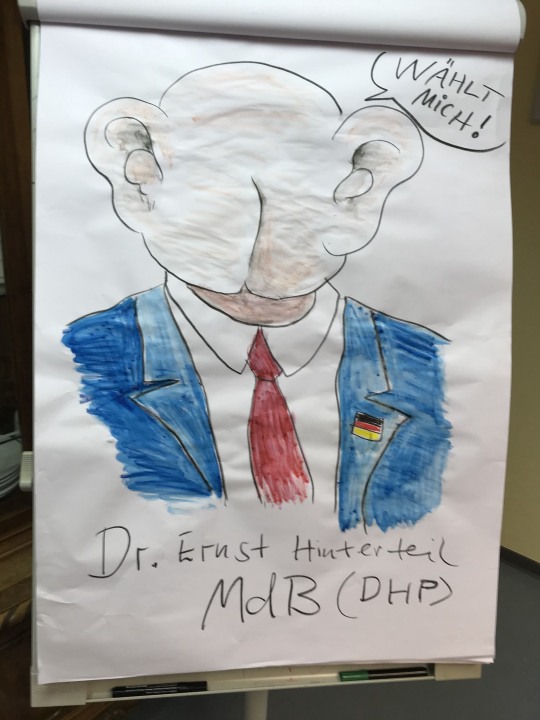Feiertagsdienst am katholischen Fronleichnam in einer evangelischen Einrichtung. Der Tag beginnt schon mit einer Art innerer Kreuzigung für eine meiner „Tagesgruppen“-Schützlinge, die 91-jährige Frau Sch. Während ich im Frühstücksraum die Lage sichte, Tische eindecke und die Anwesenden erstmal begrüße, öffnet sich die Tür zu Frau Sch.‘s Zimmer – es liegt direkt neben dem Speiseraum – und eine Pflegekraft verläßt den Raum mit den aufmunternden Worten „Und jetzt schön frühstücken gehen!“ an Frau Sch.
Ein paar Sekunden später taucht eine völlig verwirrte und konsternierte Frau Sch. auf und steckt den Kopf aus dem Türrahmen. „Was ist denn hier los? Sowas hab ich ja noch nie erlebt!!“ sagt sie, den Tränen nah. „So können die doch nicht mit mir umgehen! Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist!“
Ich ahne, dass es hier nicht um ein etwaiges unangemessenes Verhalten der Pflegekraft geht, sondern um die inneren Abgründe von Frau Sch. Also nehme ich sie erstmal in den Arm und frage, was passiert ist – obwohl ich weiß, dass gar nichts passiert ist außer Erschrecken, Nicht-Begreifen und Verunsicherung über Frau Sch.s Verlorenheit in der eigenen inneren unbekannten, immer diffuseren Fremde an diesem Morgen.
„Ich weiß gar nicht, wer ich bin! Ich glaube, ich brauch einen Psychiater. Was stimmt denn mit mir nicht?“ Sie schaut mich tränenüberströmt an. „Ich bin doch sonst eine fröhliche Person, aber heute stimmt gar nichts! Ich kann mich auch gar nicht wehren!“
„Das kann ich gut verstehen“, versichere ich ihr. „Man fühlt sich wie ein winziger Tropfen in einem riesigen Ozean, der einen verschluckt…“
Jetzt schaut sie mich an und wirkt fast erleichtert. „Ja, genau!“, sagt sie, und bekräftigt: „Ich bin bloß eine alte Frau!“ – so als würde das alles erklären, weil eine einzige kleine alte Frau gegen die Gesamtheit eines komplett unverständlichen und ständig weiter zerbröselnden Universums ja sowieso nicht ankommt.
Sie ist jetzt jedenfalls etwas entspannter und bittet mich, ihr die Tränen abzuwischen, weil sie nicht so verheult in den Speiseraum will. Gesagt, getan und den Rest erledigt ein leckerer Kaffee und die feiertäglichen Marmeladenbrote.
Als alle mehr oder weniger fertig gefrühstückt haben, stellt sich die Frage, wie wir den gemeinsamen Vormittag verbringen. Im Grunde habe ich meine wochentägliche „Tagesgruppe Demenz“ hier versammelt, erweitert um zwei oder drei Frühstücksgäste aus dem Wohnbereich.
Da Fronleichnam ist, bietet sich zum Einstieg das „Warum wird dieser Tag überhaupt gefeiert“-Ratespiel an. Das weiß natürlich keiner, auch die allerkatholischsten Leute nicht. Allerdings wissen sie das schon bei Weihnachten oder Ostern kaum oder gar nicht. Ich muss ihnen also auf die Sprünge helfen. Natürlich hat jeder schon mal den Begriff „Fron“ oder „Fronarbeit“ gehört, und was ein Leichnam ist, ist auch jedem klar. Sollte der Feiertag etwa bedeuten, dass jemand so lange Fronarbeit leisten muss, bis er tot zusammenbricht und als Leichnam liegen bleibt?
Diese auf den ersten Blick naheliegende Erklärung wird von meiner Runde nach kurzem Nachdenken verworfen, da man weiß oder ahnt, dass es mal wieder irgendwas mit Jesus zu tun hat, und der starb ja am Kreuz und nicht aus Erschöpfung von zu viel harter Arbeit. Ich löse das Rätsel und erzähle kurz und in einfachen Sätzen, worum es bei dem Feiertag geht und welches Ereignis des Neuen Testaments da begangen wird. Dass der Jesus mit seinen Freunden gerne aß und trank, leuchtet jedem ein; dass er angesichts seiner bevorstehenden Hinrichtung seine Jünger bat, in Zukunft beim Essen und Trinken an ihn zu denken, versteht auch jeder.
Wir haben zwar gerade gefrühstückt und das Brot somit schon „gebrochen“, und Wein gibt’s um die Uhrzeit natürlich erst recht nicht, aber wir prosten uns mit erhobenen Kaffeetassen zu und lassen uns und Jesus hochleben.
Nun fällt Frau N. ein, dass zu Fronleichnam immer Prozessionen stattfinden, bei denen Wald und Feld und Flur und Gemarkung gesegnet wird. Das ist ein super Hinweis, den ich gerne aufgreife. Ich verkünde meiner Truppe, dass wir aus Anlass des hohen Feiertages heute unsere eigene Prozession machen werden und frage in die Runde, was man für eine anständige Prozession so bräuchte.
In kürzester Zeit stehen diese Ingredienzen am Flipchart:
– Baldachin
– Kerze
– Kreuz
– Marienstatue
– Weihrauch
– Glocke
– Segnungs-Stab
Bis auf den Weihrauch haben wir tatsächlich alles im Haus. Ich schicke einen Kollegen los, einen Regenschirm besorgen: der wird unser Baldachin. Eine Kerze ist kein Problem; wir haben sogar einen verglasten Kerzenhalter – offenes Feuer geht aus Sicherheitsgründen nicht. Als Glocke muß uns die Stammtischglocke dienen, die ich mal für die Frühschoppen- und Stammtisch-Runden angeschafft habe.
Eine hölzerne Marienstatue von etwa 1,50 m Höhe steht tatsächlich im Keller der Einrichtung, seit die Besitzerin vor etwa 6 Monaten verstarb. Bleibt der Segnungs-Stab: ich meine mich zu erinnern, dass die Priester bei solchen Prozessionen mit irgendeinem Stab, an dem vorne ein Tuch oder ähnliches zum Wedeln befestigt ist, die Segnungen vornehmen. So greife ich mir den Gehstock eines Bewohners und schaue in Frau Sch.s Zimmer nach einem geeigneten Wedel-Utensil. Ein Damenstrumpf erfüllt den Zweck aufs Vorzüglichste.
Wir beratschlagen kurz und die Runde ist der Meinung, dass wir angesichts unserer echten Marienstatue ruhig auf das Kreuz verzichten können. Wir haben zwar eins unten im Großen Speisesaal, aber das ist zu schwer zum Rumtragen. Jetzt kann unsere Prozession beginnen!
Da die anwesenden Bewohner alle nicht mobil sind, müssen die Kollegen zum Prozessieren ran. Der zweite für heute eingeteilte Mitarbeiter des Sozialen Dienstes wird zum Kerzenträger, der muslimische Praktikant des Wohnbereiches wird als Statuenschieber und Baldachinhalter in christliche Gebräuche eingewiesen, ich bilde den Schluss der Prozession mit dem Segnungs-Stab. Die Glocke wird von der darüber hocherfreuten Frau N. geschlagen.
Dank Apple Music ist auch sogleich die passende Musik bei der Hand, und zu den Klängen von „Lauda Sion Salvatorem: Sequentia (Fronleichnam)“ drehen wir drei Runden durch den Speisesaal des Wohnbereiches. Der schöne gregorianisch anmutende Chorgesang ist wie geschaffen für meine Segnungen, die ich musikalisch versiert und melodisch akkurat allen und jedem spende.
Nachdem jeder Anwesende, das Haus selber, die Ortschaft sowie der gesamte Erdball meinen Fronleichnamssegen empfangen hat, wirken die Bewohner gelöst und beschwingt über das Zinnober, das ich keineswegs als religiöse Persiflage aufgeführt habe, sondern als unterhaltsames, aber ernstgemeintes Spektakel. Katholische Hardliner mögen so etwas als Blasphemie ansehen; ich selber billige meiner Pflegeheim-Prozession mindestens soviel Gültigkeit zu wie ihren „offiziellen“ Pendants.
Damit es nicht zu kirchlich wird, und weil es in Strömen regnet, wenden wir uns musikalisch aber wieder eingängigerem Liedgut zu und spielen und singen alle möglichen Songs, die mit Regen zu tun haben – schon wieder Gelegenheit für eine kleine Rate-Runde. Schon naht die Mittagsstunde und der Raum muss wieder anderen Zwecken gewidmet werden. Als ich die Marienstatue hinausschiebe, bemerke ich die anerkennenden und gut gelaunten Blicke vieler Anwesender – nicht mir geltend, sondern der schönen, fast lebensgroßen Holzfigur.
Frau Sch., morgens noch todtraurig und aufgelöst, wirkt jetzt munter und beglückt über die angenehme Abwechslung. Sie isst ihr Mittagessen mit Appetit und bedankt sich, als ich sie aufs Zimmer bringe und in ihr Bett lege, nochmal bei mir. Irgendetwas in ihr ist wieder „eingerenkt“, vielleicht sogar durch das Ritual in Harmonie mit der Situation gebracht worden. Morgen oder schon heute Nachmittag kann sich das bereits wieder ändern, aber in diesem Moment begibt sich eine zufriedene und sehr entspannte Frau Sch. zum Mittagsschlaf.